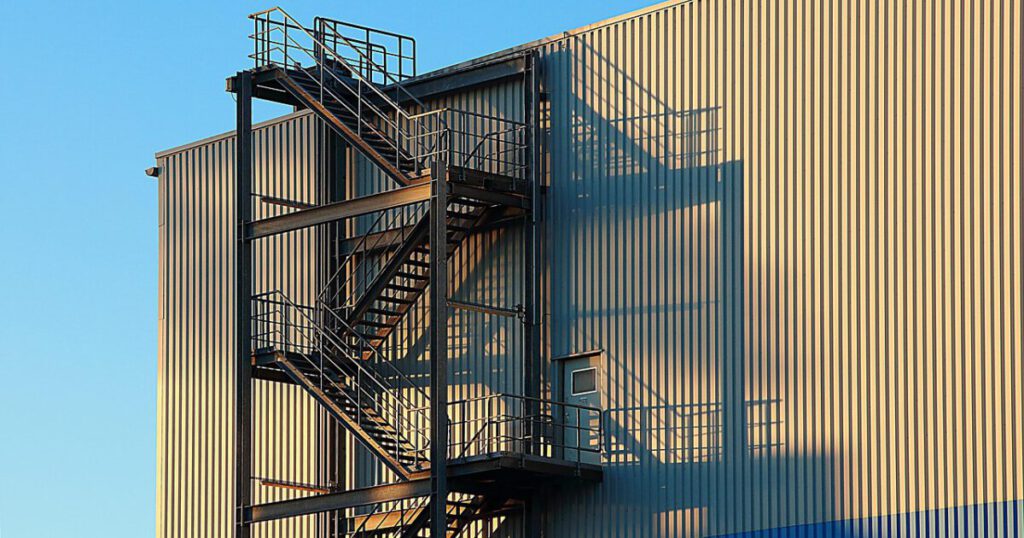
Im Zuge der Ausweisung eines Gewerbegebiets auf der „Finckwiese“ kam die Frage nach einer SoBoN-Regelung auf.
Zudem wurde bei der Umsetzung der städtebaulichen Verträge über die Belegungsrechte der mietpreisgedämpften Wohnungen im Rahmen des Haarer Modells wiederholt der Vorschlag gemacht, künftig Wohnraum in das Eigentum der Stadt Haar zu überführen. Zu diesen beiden Fragestellungen nahm Rechtsanwalt Michael Beisse von der Rechtsanwaltskanzlei Döring-Spiess in der Sitzung wie folgt Stellung:
„Grundsätzlich können SoBoN-Grundsätze Verpflichtungen für Planbegünstigte festlegen, die als Voraussetzung für die Einleitung der Bauleitplanung wie auch für die Durchführung und den Abschluss der Bauleitplanung angesehen werden können:
- Der Einstieg in die Bauleitplanung kann davon abhängig gemacht werden, dass die Stadt Miteigentumsanteile (bis zu 100%) an den zu überplanenden Flächen erwirbt. Dieser Flächenerwerb ist günstigstenfalls noch vor einem Aufstellungsbeschluss zu tätigen. Er muss zum Verkehrswert im Zeitpunkt des Ankaufs erfolgen und sollte von städtebaulichen Gründen getragen sein. Die Verwendung der Grundstücke, die die Stadt zu Beginn der Bauleitplanung erworben hat, muss zur Zielerreichung der mit dem Erwerb verfolgten städtebaulichen Ziele erfolgen; der (Zwischen-)Erwerb durch die Stadt sollte dazu dienen, die städtebaulichen Ziele überhaupt oder zumindest besser zu erreichen, als ohne städtische Eigentumsstellung. Ist zur Zielerreichung eine Veräußerung der Grundstücke an Dritte vorgesehen oder gar erforderlich, sind die von Städten bei der Veräußerung von Grundstücken allgemein zu beachtenden Grundsätzen zu beachten.
- Die Durchführung und der Abschluss einer Bauleitplanung kann davon abhängig gemacht werden, dass die Planbegünstigten sich in städtebaulichen Verträgen verpflichten, die von der Stadt verfolgten städtebaulichen Ziele zu erfüllen. Die Verpflichtungen müssen in einem kausalen Zusammenhang mit der Bauleitplanung stehen und angemessen sein; unzulässig ist eine Verpflichtung für eine Gegenleistung, auf die der Planbegünstigte auch ohne Bauleitplanung einen Anspruch hätte (Koppelungsverbot).
- Eine reine bzw. ausschließliche Plangewinnabschöpfung durch Zwischenerwerb oder Auferlegung städtebaulich-vertraglicher Verpflichtungen ist unzulässig.
SoBoN und Gewerbegebiete? Leider kaum denkbar
Im Zusammenhang mit der Entwicklung gewerblichen Baulandes sind aus dem Bereich der sozialen Bodenordnung leider kaum städtebauliche Zielsetzungen denkbar, die einen (Zwischen-)Erwerb durch die Gemeinde erfordern oder die zur Umsetzung einer städtebaulich-vertraglichen Verpflichtung der Planbegünstigten bedürfen. Hierzu ist zum Vergleich zunächst ein Blick auf die Rechtslage bei der Wohnbaulandschaffung erhellend: hier formuliert das Gesetz bereits in § 1 Abs. 6 Nr. 2 und 3 entsprechende bei der Bauleitplanung zu berücksichtigenden Belangen, die als SoBoN-Regelung Grundlage für einen Eigentumserwerb der Gemeinde oder entsprechende Verpflichtungen der Planbegünstigten sein können. Zudem werden „SoBoN-Bindungen“ in § 11 Abs. 1 Nr. 2 BauGB ausdrücklich als möglicher Inhalt eines städtebaubaulichen Vertrages genannt.
§ 1 Abs. 6 Nr. 2 und 3 nennen als bei der Bauleitplanung zu berücksichtigenden Belange: die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere auch von Familien mit mehreren Kindern, die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen, die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung und die Anforderungen kostensparenden Bauens sowie die Bevölkerungsentwicklung, die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere die Bedürfnisse der Familien, der jungen, alten und behinderten Menschen, unterschiedliche Auswirkungen auf Frauen und Männer sowie die Belange des Bildungswesens und von Sport, Freizeit und Erholung.
Vor allem die „Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen, die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung, die Bedürfnisse der Familien, der jungen, alten und behinderten Menschen“ lassen sich gesichert nur über vertragliche Verpflichtungen beim Verkauf von städtischen Grundstücken oder in städtebaulichen Verträgen durch- und umsetzen. Der zuvor bezeichnete § 11 Abs. 1 Nr. 2 BauGB nennt als möglichen Gegenstand eines städtebaulichen Vertrages „die Deckung des Wohnbedarfs von Bevölkerungsgruppen mit besonderen Wohnraumversorgungsproblemen sowie der Erwerb angemessenen Wohnraums durch einkommensschwächere und weniger begüterte Personen der örtlichen Bevölkerung“.
Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, dass nach der Bayerischen Verfassung die „Förderung des Baus billiger Volkswohnungen“ Aufgabe auch der Gemeinden ist, Art. 106 Abs. 2 BayVerf. Vergleichbare Grundlagen fehlen aber für die Entwicklung gewerblichen Baulandes: in den Planungsgrundsätzen des § 1 Abs. 6 BauGB taucht in Nr. 8a) zwar als Belang der der „Wirtschaft“ auf, ohne dies jedoch zu präzisieren auf – z.B. – ortsansässiges Gewerbe o.ä.. In § 1 Abs. 6 Nr. 8c) werden als Belang die Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen genannt – auch hier jedoch ohne weiteren Bezug auf Gewerbebetriebe (weder auf Gewerbe generell und auch nicht auf ortsansässige Betriebe o.ä.). Im Katalog des § 11 Abs. 1 BauGB, der die Gegenstände städtebaulicher Verträge beispielhaft aufzählt, finden sich überhaupt kein Bezug zu Nutzungen in Gewerbe- und/oder Industriegebieten.
Aufgrund dessen scheidet eine grundsätzliche SoBoN-Regelung bei der Entwicklung gewerblichen Baulands aus. Entsprechende städtebauliche Zielsetzungen, die auch im weitesten Sinne als SoBoN-fähig gelten könnten, können allenfalls ausnahmsweise vorliegen. Dies z.B. dann, wenn in bestehenden Gemengelagen Immissionskonflikte bestehen, die nur durch eine Absiedlung von Gewerbebetrieben gelöst werden können – die Gemeinde muss dazu im zu entwickelnden Bereich Grundstücke erwerben, die sie dann gezielt an die abzusiedelnden Gewerbebetriebe veräußert (allerdings ist dabei die Veräußerung wohl nur zu den jeweils gültigen Verkehrswerten – und nicht wie bei „Einheimischenbauland“ unter Wert, möglich).
Auch in dem genannten Beispielfall liegt dann aber die städtebauliche Rechtfertigung zuvörderst in der Schaffung gesunder Wohnverhältnisse – §1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB – und erst in zweiter Linie in der Schaffung von Gewerbeflächen für ganz bestimmte Betriebe. Vergleichbar als Rechtfertigung wäre auch die Verbesserung der Arbeitssicherheit, wenn dies am bestehenden Betriebsstandort – auch hier zunächst als Belang des § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB.“
Das Fazit des Experten
Nur wenn sich derartige städtebauliche Gründe finden lassen, könnte bei der Entwicklung der „Finckwiese“ eine „Gewerbe-SoBoN“-Regelung entworfen und vorgeschlagen werden. Finden sich diese Gründe nicht, ist eine SoBoN bei der Entwicklung des gewerblichen Baulands nicht realisierbar.